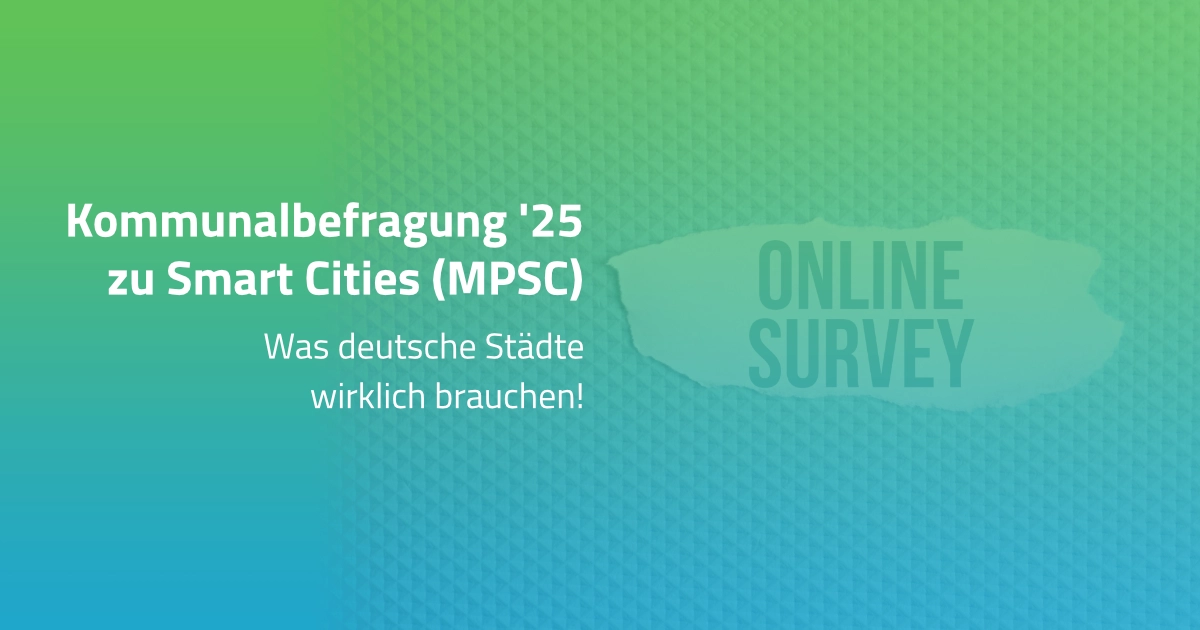Was deutsche Städte wirklich brauchen – Ergebnisse und Perspektiven der Kommunalbefragung 2025
Bis zum 11. April 2025 hatten deutsche Kommunen die Gelegenheit, ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Wünsche im Rahmen des Bundesförderprogramms "Modellprojekte Smart Cities" (MPSC) zu teilen. Ziel war es, konkrete Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung der Smart-City-Strategie Deutschlands abzuleiten.
1 | Hintergrund: Warum die Kommunalbefragung 2025 entscheidend ist
Ziel der bundesweiten Befragung ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie das MPSC-Programm die digitale und nachhaltige Stadtentwicklung beeinflusst, welche Herausforderungen Kommunen dabei sehen und welche Bedarfe bestehen.
Teilnehmen konnten alle Städte, Kreise und Gemeinden, die nicht selbst Teil des Förderprogramms sind. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, den Wissenstransfer sowie zukünftige Förderansätze gezielt weiterzuentwickeln.
2 | Kernergebnisse der Befragung
2.1 Herausforderungen jenseits der Finanzierung
Die Befragung zeigt deutlich: Nicht allein fehlende Mittel bremsen die Digitalisierung aus. Vielmehr nennen Kommunen organisatorische, rechtliche und personelle Herausforderungen als wesentliche Hindernisse. Wie bereits beim 6. MPSC-Kongress in München deutlich wurde, handelt es sich hierbei um tief verwurzelte Probleme in Verwaltungsstrukturen, die die Digitalisierung massiv erschweren. Konkret wurden auf dem Kongress unklare Zuständigkeiten zwischen Fachbereichen und IT-Abteilungen als häufigste Hürde genannt. Ebenso wurde ein deutlicher Mangel an qualifiziertem Personal mit digitalem Know-how kritisiert, sowie bürokratische Hindernisse bei der Vergabe innovativer Projekte (Smart City ist digitale Notwehr).
2.2 Wunsch nach Standards und interoperablen Lösungen
Ein zentrales Ergebnis ist der Wunsch nach mehr Standardisierung. 78 % der Kommunen wünschen sich eine bessere Vernetzung bestehender Lösungen, um Insellösungen zu vermeiden. Datahubs und Connected Urban Twins gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie eine flexible und skalierbare Vernetzung städtischer Daten ermöglichen. So könnten Kommunen standardisierte digitale Infrastruktur effizient nutzen, um sowohl die interkommunale Zusammenarbeit zu verbessern als auch innovative Anwendungen schneller umzusetzen (Potenziale von Datahubs und Connected Urban Twins).
2.3 Bürgerbeteiligung und Transparenz als Erfolgsfaktor
Rund 65 % der Städte nennen mangelnde Bürgerakzeptanz als Risiko. Es besteht die klare Forderung nach neuen, niedrigschwelligen Beteiligungsformaten. Gelungene Beispiele aus Köln, Hamburg oder Karlsruhe zeigen, dass digitale Tools helfen können, Akzeptanz und Engagement deutlich zu erhöhen. Besonders wichtig sind schnelle Experimente und klar kommunizierte Mehrwerte, wie etwa das Kölner Projekt „un:box“, welches gezielt Bürgerpartizipation und Transparenz fördert (Wie Kommunen die digitale Zukunft gestalten).
3 | Konsequenzen für die Smart-City-Strategie
3.1 Überdenken der Förderlogik
Die Erkenntnisse der Befragung erfordern ein Umdenken bei zukünftigen Förderinstrumenten. Neben einer reinen Projektfinanzierung sollte stärker in nachhaltige Strukturen und langfristige Kooperationen investiert werden.
3.2 Aufbau digitaler Kompetenzzentren
Zur Lösung der Personalfrage schlagen viele Kommunen regionale digitale Kompetenzzentren vor, die Weiterbildung, Austausch und Beratung vor Ort anbieten könnten.
3.3 Bundesweite Open-Source-Initiative
Kommunen wünschen sich eine stärkere Rolle des Bundes bei der Bereitstellung offener Standards und zentraler digitaler Infrastrukturen.
4 | Best Practice: Wie es andere Länder machen – Beispiele und Impulse für Schleswig-Holstein
Estland setzt konsequent auf Open-Source-Standards. Schleswig-Holstein hat eine ähnliche umfassende Open-Source-Strategie entwickelt (Open-Source-Strategie SH).
Finnland fördert regionale Innovationscluster. Schleswig-Holstein verfolgt diesen Ansatz mit Initiativen wie dem KI-Transfer-Hub und dem InnovationLab SH (InnovationLab SH).
Dänemark hat eine klare, kontinuierlich angepasste Digitalstrategie. Schleswig-Holstein folgt diesem Ansatz mit einer fortlaufend aktualisierten Digitalstrategie (Digitalstrategie SH).
5 | Handlungsempfehlungen für deutsche Kommunen
Klare Verantwortlichkeiten, Kompetenzzentren, interoperable Technologien und frühzeitige Bürgerbeteiligung.
6 | Mein persönliches Fazit
Die Kommunalbefragung 2025 bietet eine wertvolle Standortbestimmung. Jetzt gilt es, diese Forderungen in konkrete Strategien umzusetzen.