
- Details
- Geschrieben von: Moritz Conjé
- Kategorie: Gesellschaft
Einleitung: Technik als Ausdruck unseres Selbst
Technik ist mehr als nur ein Werkzeug – sie ist der Spiegel unserer eigenen Kreativität und unseres Verständnisses von der Welt. Als „Homo Creator“ begreifen wir den Menschen als aktiv schöpferisches Wesen, das durch Technik seine Umwelt gestaltet und dabei immer auch ein Stück weit sich selbst definiert. In einer zunehmend digitalisierten Welt wird diese Perspektive spannender und relevanter denn je. Persönlich beschäftige ich mich täglich mit diesen Fragen: Welche Rolle spielt Technik in meinem Leben und in dem der Gesellschaft? Und wie verändert sie uns?
Homo Creator: Mehr als nur Werkzeugmacher
Der Begriff „Homo Creator“ hebt besonders hervor, dass wir Menschen nicht bloß Werkzeuge erschaffen, sondern ganze Welten. Während der „Homo Faber“ als Handwerker das Praktische in den Mittelpunkt stellt, betont der „Homo Creator“ unsere kreative und reflexive Seite. Technik ist nicht neutral, sondern spiegelt unsere Werte, Visionen und sogar unsere Ängste wider.
Als Projektmanager in einem IT-Unternehmen erlebe ich genau das immer wieder: Software, Apps oder Smart Gadgets lösen nicht nur praktische Probleme, sie beeinflussen, wie wir miteinander umgehen und unsere Welt wahrnehmen. Technikgestaltung ist immer auch Kulturgestaltung – und genau darin liegt die Faszination.
Technik als kulturelle Praxis: Ein persönlicher Einblick
Technik formt und verändert unsere Kultur. Persönlich fasziniert mich vor allem, wie smarte Technologien, etwa Smart Cities oder Smart Regions, unsere Lebensweise prägen und neu definieren. Dabei geht es nicht nur um Effizienz und Optimierung, sondern auch um die Frage, wie Technik unser Zusammenleben verbessert.
In meinen Blogbeiträgen und in meinem beruflichen Alltag versuche ich deshalb immer, Technik aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten:
- Welche Auswirkungen hat z.B. eine Smart-City-Lösung wirklich auf den Alltag der Menschen?
- Welche Vorteile und Erleichterungen bieten diese, welche Anforderungen und Mitwirkung verlangt diese aber auch?
- Welche Fragen muss man beantworten, um weitere Menschen von den Vorteilen zu überzeugen und Ängste und Vorbehalte abzubauen?
- Welche ethischen und kulturellen Fragen tauchen auf, wenn wir immer mehr Prozesse digitalisieren und automatisieren?
Persönliche Reflexion: Mein Weg als Homo Creator
Mein eigener Weg als Homo Creator ist geprägt von Neugier, Kreativität und Reflexion. Technik war für mich nie nur Mittel zum Zweck, sondern immer Ausdrucksmittel und Gestaltungsraum zugleich. Ob bei der Entwicklung neuer Projekte oder in meiner persönlichen Leidenschaft für Fotografie und Gadgets – überall zeigt sich für mich das kreative Potenzial der Technik.
Meine Website und mein Blog sind Orte, an denen ich genau das teile: meine Begeisterung für innovative Technologien, aber auch meine Gedanken darüber, wie diese unsere Gesellschaft und unseren Alltag beeinflussen. Als Homo Creator nutze ich meine Plattformen, um nicht nur über Technik zu informieren, sondern um bewusst und kritisch zu gestalten.
Aus dem Blickwinkel der beruflichen Arbeit und des privaten Alltags stellen sich dabei immer wieder die Fragen:
- Welche Arbeit und Aufgaben erleichtert mir die Nutzung von Technologie wirklich?
- Ist ggf. irgendwann der Break-Even-Point erreicht, an dem der Aufwand zur Pflege des technischen Systems seinen Nutzen im Alltag übersteigt?
Diese Reflexion ist der Kern dessen, was den Homo Creator ausmacht.
Verantwortung des Homo Creator: Gestalter sein, nicht bloß Nutzer
Mit der Macht, Welten zu gestalten, kommt auch eine große Verantwortung. Wir entscheiden heute, in welcher Welt wir morgen leben werden. Als „Homo Creator“ sind wir nicht nur passive Konsumenten, sondern aktive Gestalter. Persönlich sehe ich darin sowohl eine Herausforderung als auch eine unglaubliche Chance.
Gerade in meinem beruflichen Umfeld, wo IT-Lösungen entwickelt und implementiert werden, merke ich immer wieder: Technik verändert Gesellschaft – und nicht umgekehrt. Deshalb ist es mir ein Anliegen, bei allen Projekten, an denen ich mitwirke, nicht nur technische Anforderungen zu erfüllen, sondern auch ethische und soziale Aspekte bewusst mitzudenken und Verantwortung zu übernehmen.
Politische Dimension: Digitale Souveränität als Chance
Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Diskussion um digitale Souveränität bietet sich uns als Homo Creator eine einzigartige Chance. Europa erkennt zunehmend, wie abhängig es von großen US-Tech-Konzernen geworden ist, und sieht darin eine Herausforderung, aber vor allem eine große Möglichkeit, sich selbst neu zu positionieren. Durch gezielte Investitionen in europäische Technologien und die Förderung eigener digitaler Ökosysteme könnte Europa seine Innovationsfähigkeit stärken und langfristig unabhängiger werden.
Als Gestalter der digitalen Welt liegt es an uns, diese Chance zu ergreifen und aktiv mitzugestalten. Es geht dabei nicht nur um wirtschaftliche Vorteile, sondern auch darum, kulturelle Werte und demokratische Prinzipien in der digitalen Ära nachhaltig zu sichern.
Schleswig-Holstein als Vorreiter: Der Weg zur digitalen Souveränität
Am Beispiel von Schleswig-Holstein kann man erkennen, dass digitale Souveränität kein abstraktes Ideal sein muss, sondern konkrete politische und technologische Entscheidungen erfordert. Mit der klaren strategischen Ausrichtung auf Open Source versucht das Land ein starkes Zeichen für Unabhängigkeit und Transparenz zu setzen. Die Umstellung von proprietärer Software auf freie Alternativen verdeutlicht diesen mutigen Schritt.
Trotz dieser Vorreiterrolle gibt es noch erhebliche Herausforderungen: Neben der technischen Umstellung sind kulturelle Veränderungen und umfassende Schulungen nötig, um Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen und die Strategie nachhaltig zu verankern.
Fazit: Die Zukunft liegt in unseren Händen
Der Begriff Homo Creator erinnert uns daran, dass wir als Menschen immer Gestalter unserer Zukunft sind. Technik ist nicht nur etwas, das uns widerfährt – es ist etwas, das wir aktiv formen und verantworten müssen. Genau darin liegt die größte Motivation: nicht nur reagieren, sondern agieren.
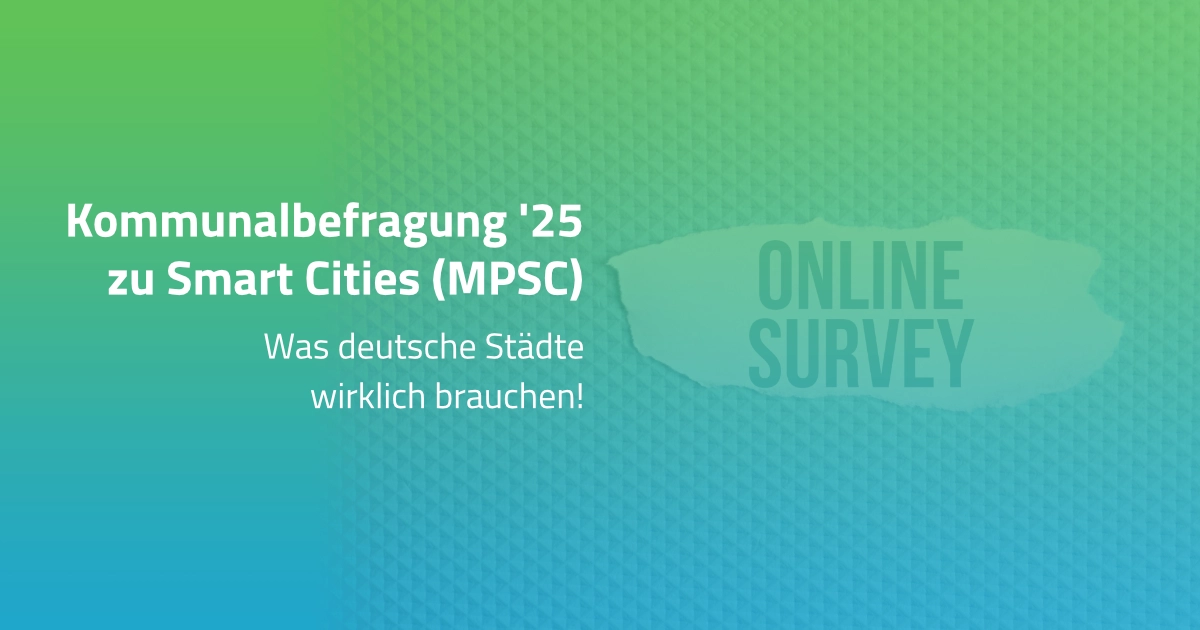
- Details
- Geschrieben von: Moritz Conjé
- Kategorie: Gesellschaft
Was deutsche Städte wirklich brauchen – Ergebnisse und Perspektiven der Kommunalbefragung 2025
Bis zum 11. April 2025 hatten deutsche Kommunen die Gelegenheit, ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Wünsche im Rahmen des Bundesförderprogramms "Modellprojekte Smart Cities" (MPSC) zu teilen. Ziel war es, konkrete Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung der Smart-City-Strategie Deutschlands abzuleiten.
1 | Hintergrund: Warum die Kommunalbefragung 2025 entscheidend ist
Ziel der bundesweiten Befragung ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie das MPSC-Programm die digitale und nachhaltige Stadtentwicklung beeinflusst, welche Herausforderungen Kommunen dabei sehen und welche Bedarfe bestehen.
Teilnehmen konnten alle Städte, Kreise und Gemeinden, die nicht selbst Teil des Förderprogramms sind. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, den Wissenstransfer sowie zukünftige Förderansätze gezielt weiterzuentwickeln.
2 | Kernergebnisse der Befragung
2.1 Herausforderungen jenseits der Finanzierung
Die Befragung zeigt deutlich: Nicht allein fehlende Mittel bremsen die Digitalisierung aus. Vielmehr nennen Kommunen organisatorische, rechtliche und personelle Herausforderungen als wesentliche Hindernisse. Wie bereits beim 6. MPSC-Kongress in München deutlich wurde, handelt es sich hierbei um tief verwurzelte Probleme in Verwaltungsstrukturen, die die Digitalisierung massiv erschweren. Konkret wurden auf dem Kongress unklare Zuständigkeiten zwischen Fachbereichen und IT-Abteilungen als häufigste Hürde genannt. Ebenso wurde ein deutlicher Mangel an qualifiziertem Personal mit digitalem Know-how kritisiert, sowie bürokratische Hindernisse bei der Vergabe innovativer Projekte (Smart City ist digitale Notwehr).
2.2 Wunsch nach Standards und interoperablen Lösungen
Ein zentrales Ergebnis ist der Wunsch nach mehr Standardisierung. 78 % der Kommunen wünschen sich eine bessere Vernetzung bestehender Lösungen, um Insellösungen zu vermeiden. Datahubs und Connected Urban Twins gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie eine flexible und skalierbare Vernetzung städtischer Daten ermöglichen. So könnten Kommunen standardisierte digitale Infrastruktur effizient nutzen, um sowohl die interkommunale Zusammenarbeit zu verbessern als auch innovative Anwendungen schneller umzusetzen (Potenziale von Datahubs und Connected Urban Twins).
2.3 Bürgerbeteiligung und Transparenz als Erfolgsfaktor
Rund 65 % der Städte nennen mangelnde Bürgerakzeptanz als Risiko. Es besteht die klare Forderung nach neuen, niedrigschwelligen Beteiligungsformaten. Gelungene Beispiele aus Köln, Hamburg oder Karlsruhe zeigen, dass digitale Tools helfen können, Akzeptanz und Engagement deutlich zu erhöhen. Besonders wichtig sind schnelle Experimente und klar kommunizierte Mehrwerte, wie etwa das Kölner Projekt „un:box“, welches gezielt Bürgerpartizipation und Transparenz fördert (Wie Kommunen die digitale Zukunft gestalten).
3 | Konsequenzen für die Smart-City-Strategie
3.1 Überdenken der Förderlogik
Die Erkenntnisse der Befragung erfordern ein Umdenken bei zukünftigen Förderinstrumenten. Neben einer reinen Projektfinanzierung sollte stärker in nachhaltige Strukturen und langfristige Kooperationen investiert werden.
3.2 Aufbau digitaler Kompetenzzentren
Zur Lösung der Personalfrage schlagen viele Kommunen regionale digitale Kompetenzzentren vor, die Weiterbildung, Austausch und Beratung vor Ort anbieten könnten.
3.3 Bundesweite Open-Source-Initiative
Kommunen wünschen sich eine stärkere Rolle des Bundes bei der Bereitstellung offener Standards und zentraler digitaler Infrastrukturen.
4 | Best Practice: Wie es andere Länder machen – Beispiele und Impulse für Schleswig-Holstein
Estland setzt konsequent auf Open-Source-Standards. Schleswig-Holstein hat eine ähnliche umfassende Open-Source-Strategie entwickelt (Open-Source-Strategie SH).
Finnland fördert regionale Innovationscluster. Schleswig-Holstein verfolgt diesen Ansatz mit Initiativen wie dem KI-Transfer-Hub und dem InnovationLab SH (InnovationLab SH).
Dänemark hat eine klare, kontinuierlich angepasste Digitalstrategie. Schleswig-Holstein folgt diesem Ansatz mit einer fortlaufend aktualisierten Digitalstrategie (Digitalstrategie SH).
5 | Handlungsempfehlungen für deutsche Kommunen
Klare Verantwortlichkeiten, Kompetenzzentren, interoperable Technologien und frühzeitige Bürgerbeteiligung.
6 | Mein persönliches Fazit
Die Kommunalbefragung 2025 bietet eine wertvolle Standortbestimmung. Jetzt gilt es, diese Forderungen in konkrete Strategien umzusetzen.
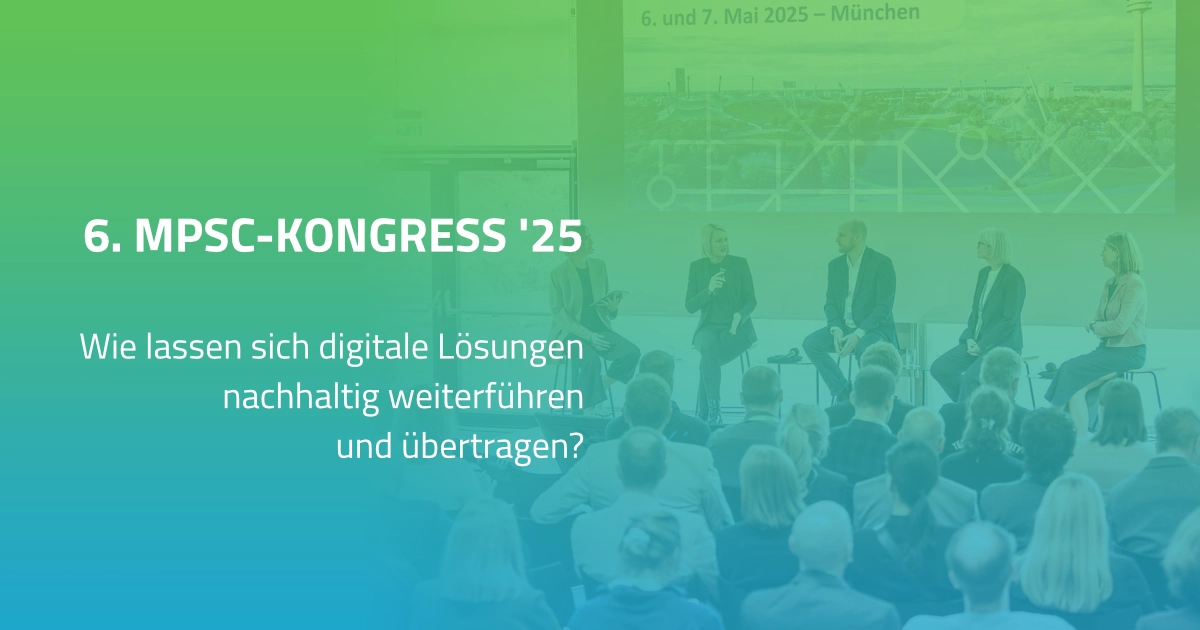
- Details
- Geschrieben von: Moritz Conjé
- Kategorie: Gesellschaft
Warum dieser Kongress zählt
Am 6. und 7. Mai 2025 trafen sich gut 200 Vertreter-innen aus über 70 deutschen Kommunen im Munich Urban Colab, um darüber zu diskutieren, wie sich die Ergebnisse des Bundes-Förderprogramms „Modellprojekte Smart Cities“ verstetigen lassen. Das Treffen fand bewusst im 11.000 m² großen Innovations-Hub statt, in dem Stadtverwaltung, Start-ups und Forschung täglich zusammenarbeiten - der perfekte Resonanzraum für erprobte wie auch radikale Ideen.
Drei Kernbotschaften aus München
2.1 Blick über die Förderlogik hinaus
„Wenn es gelingt, zwei Drittel der entwickelten Lösungen weiter zu betreiben, wäre das ein Riesenerfolg für ein experimentell angelegtes Förderprogramm.“ - Renate Mitterhuber, BMWSB
Die Projektverantwortlichen im Bund stellen klar: Ab 2026 endet für viele Modellkommunen die eigentliche Finanzierungsphase. Entscheidend ist also, schon heute Betriebs-, Lizenz- und Updatekosten mitzudenken - und früh Kooperationspartner aus der Region an Bord zu holen.
2.2 Open Source = Digitale Souveränität
Michael Huch (KTS) sprach offen über die „Herausforderung Open Source“: Die Verpflichtung, Ergebnisse quelloffen bereitzustellen, sorge zunächst für Extra-Aufwand, sei aber „ein wichtiger Schlüssel, damit Kommunen ihre digitale Zukunft selbst gestalten können.“ Öffentlicher Code senkt Einstiegshürden für Nachahmer-Städte und erleichtert Ausschreibungen.
2.3 Digitalisierung als Pflichtaufgabe
In einer pointierten Panel-Diskussion brachte Susanne Klöpping (StMD) den Stimmungsumschwung auf den Punkt:
„Smart City ist digitale Notwehr. Digitalisierung ist Voraussetzung, damit Kommunen überhaupt noch handlungsfähig bleiben.“
Die Botschaft traf: Wer heute nicht digitalisiert, gefährdet morgen Daseinsvorsorge und Standortattraktivität.
Best Practice: Der Digitale Zwilling Münchens
Ein Highlight war die Live-Demo des Digital Twin Munich. Die Stadt nutzt ein zentrales 3D-Modell samt Urban Data Platform, um Klima-Simulationen, Verkehrsflüsse und Bauvorhaben virtuell durchzuspielen. Die offene Architektur erlaubt die Anbindung externer Echtzeit-Daten - von Feinstaub-Sensoren bis Radverkehrszählungen.
Warum das relevant ist:
- Schnelle „Was-wäre-wenn“-Szenarien machen politische Folgen transparent.
- Bürger-Feedback lässt sich direkt in Modellläufen berücksichtigen.
- Kommunen ohne Millionen-Budget können modular andocken - Open Source sei Dank.
Fehler feiern - die „Fuck-up-Night“
Eine abendliche „Fuck-up-Night“ bot Raum für gescheiterte Projekte: Undichte Grundwassersensoren, datenschutzrechtliche Sackgassen oder Displays, die auf dem falschen Platz landeten. Die Offenheit erzeugte Lernkurven, die man so in klassischen Fachkonferenzen selten erlebt - ein Format, das jede Kommune kopieren sollte, bevor sie nächste Millionen investiert.
Lessons Learned für Kommunen aus den Handlungsfeldern und Quick-Tipp
Betrieb & Skalierung
Schon in der Pilotphase Service-Level, Wartungsaufwand und Kosten für Cloud-Hosting beziffern.
Digitale Zwillinge
Mit einem klaren Use-Case (z. B. Schulwegsicherheit) starten statt das „volle 3D-Abbild“ anzustreben.
Open Source
Git-Repository vor Projektstart anlegen; Lizenz (EUPL/ MIT) gemeinsam mit Rechtsamt definieren.
Governance
Interdisziplinäres Kernteam etablieren, das Fachbereiche, IT und Kommunikationsstelle vereint.
Fehlerkultur
Quartalsweise interne „Pre-Mortems“ und offene Review-Sessions durchführen - Erkenntnisse veröffentlichen.
Mein Fazit
Der 6. MPSC-Kongress hat gezeigt: Deutschlands Smart-City-Bewegung ist aus der Experimentier-Ecke herausgewachsen. Statt Leuchtturm-PR dominieren Transfer, Standards und Nachhaltigkeit. Der Satz „Digitale Notwehr“ mag drastisch klingen, trifft aber häufig die Realität in Verwaltung, Ministerien und Amtsstuben.
Für mich heißt das:
- Finanzierungs- und Betriebsmodelle rücken in den Mittelpunkt jeder Strategie.
- Open-Source-Pfadabhängigkeiten müssen früh mit Einkauf und IT-Sicherheit abgestimmt werden.
- Kommunen sollten Fehler als Vermögenswert behandeln - geteilte Misserfolge sparen anderswo teures Lehrgeld.

- Details
- Geschrieben von: Moritz Conjé
- Kategorie: Gesellschaft
Die bisherigen Beiträge haben die Grundlagen der Stadtentwicklung sowie die Rolle von Smart Cities im digitalen Zeitalter beleuchtet. Aufbauend auf diesen Konzepten widmen wir uns nun den technischen und strukturellen Elementen, die als Kern der Digitalisierung moderner Städte gelten: Datahubs und Connected Urban Twins. Diese Infrastrukturen stellen die nächste Entwicklungsstufe in der Stadtentwicklung dar und ermöglichen neue Ansätze zur Planung, Verwaltung und Gestaltung urbaner Räume.
Datahubs und Connected Urban Twins sind nicht nur Werkzeuge der Digitalisierung, sondern auch Brücken zwischen der physischen und digitalen Welt. Sie bilden die Basis für datengetriebene Entscheidungen und fördern eine nachhaltige sowie bürgerorientierte Stadtentwicklung. Dieser Artikel erklärt die Konzepte, beleuchtet ihre Vorteile und zeigt konkrete Einsatzmöglichkeiten auf.
Was sind Datahubs und Connected Urban Twins?
Datahubs
Ein Datahub ist eine zentrale Plattform, die Daten aus verschiedenen Quellen sammelt, integriert und zugänglich macht. In einer Stadt können dies Sensoren, Geodaten, Verkehrsdaten oder auch Bürgerfeedback sein. Datahubs ermöglichen:
- Zentrale Datenverwaltung: Daten werden standardisiert und sicher gespeichert. Dies umfasst die Vereinheitlichung von Daten durch die Verwendung gängiger Datenmodelle wie CityGML oder INSPIRE. Diese Standards gewährleisten eine hohe Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen und erleichtern den Austausch von Daten über Stadt- und Landesgrenzen hinweg. Ein einheitliches Datenmodell sorgt zudem dafür, dass Daten schneller verarbeitet und für Analysen sowie Simulationen genutzt werden können. Dadurch wird nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch die Grundlage für datengetriebene Entscheidungen geschaffen.
- Echtzeitdaten: Entscheidungsträger können auf aktuelle Informationen zugreifen. Durch die Verknüpfung und Analyse dieser Daten können Zusammenhänge zwischen verschiedenen Datensätzen erkannt und neue Erkenntnisse gewonnen werden. Dies ermöglicht eine tiefere Einsicht in städtische Prozesse und eine fundierte Grundlage für strategische Entscheidungen.
- Datagovernance: Dies umfasst Aspekte wie:
- Datenqualität: Sicherstellung, dass alle Daten vollständig, konsistent und aktuell sind.
- Datensicherheit: Schutz vor unbefugtem Zugriff und Sicherstellung der Einhaltung von Datenschutzrichtlinien.
- Zugriffsrechte: Definition, welche Akteure Zugriff auf spezifische Datensätze haben und wie diese genutzt werden dürfen.
- Transparenz: Klare Dokumentation der Herkunft, Verarbeitung und Nutzung von Daten.
- Standardisierung: Festlegung von einheitlichen Datenformaten und Protokollen, um die Interoperabilität zu gewährleisten.
- Langfristige Speicherung: Strategien zur Archivierung und Versionierung von Daten für zukünftige Verwendungszwecke.
- Offene Schnittstellen: Externe Entwickler und Forschungseinrichtungen können Anwendungen basierend auf diesen Daten entwickeln. Durch die Bereitstellung von Open Data werden diese Daten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und können von Bürgerprojekten genutzt werden. Ein Beispiel ist das Projekt "Luftdaten.info", bei dem Bürger eigene Feinstaubsensoren installieren und die Messwerte in eine offene Datenbank hochladen, um gemeinsam die Luftqualität zu verbessern. Ein weiteres Beispiel ist "ParkenHD", ein Projekt, das Parkraumsensoren und geöffnete Verkehrsdaten nutzt, um freie Parkplätze in Heidelberg anzuzeigen und den Verkehr zu entlasten.
Ein bekanntes Beispiel ist das Urban Data Hub Hamburg, das umfassende Daten zu Mobilität, Energie und Umwelt bereitstellt. Diese Daten werden bereits in Projekten wie "GreenCity" genutzt, das auf Basis von Verkehrs- und Umweltdaten Strategien zur Reduzierung von Emissionen entwickelt, sowie im "Smart Traffic Hamburg"-Projekt, das durch die Analyse von Echtzeit-Verkehrsdaten die Verkehrsflüsse optimiert. Mehr dazu auf hamburg.de.
Connected Urban Twins
Connected Urban Twins (CUT) erweitern das Konzept der Datahubs, indem sie digitale Abbilder urbaner Räume erstellen. Diese digitalen Zwillinge ermöglichen:
- Simulationen: Zukünftige städtebauliche Szenarien können getestet werden.
- Bürgerbeteiligung: Über interaktive Plattformen können Bürger direkt an Planungsprozessen teilnehmen.
- Interkommunale Zusammenarbeit: Mehrere Städte können ihre Daten und Erfahrungen teilen, um gemeinsame Lösungen zu entwickeln.
Das Connected Urban Twins-Projekt (CUT) von Hamburg, Leipzig und München demonstriert eindrucksvoll die Möglichkeiten dieser Technologie. Es wird für Flächenplanung, Klimaschutz und soziale Transformation genutzt. Details auf connectedurbantwins.de.
Vorteile für die Stadtentwicklung
Nachhaltigkeit und Resilienz
Datahubs und Connected Urban Twins fördern nachhaltige und resiliente Stadtstrukturen. Durch die Integration von Echtzeitdaten können Städte schneller auf Umweltveränderungen reagieren und Ressourcen effizienter nutzen.
Verbesserte Planung
Planungsprozesse werden durch datengetriebene Ansätze transparenter und präziser. So können z. B. Verkehrsströme optimiert oder neue Quartiere nachhaltiger gestaltet werden.
Bürgerorientierung
Durch digitale Zwillinge und offene Datenplattformen wird die Beteiligung der Bürger an Entscheidungsprozessen erleichtert. Tools wie DIPAS (Digitales Partizipationssystem) ermöglichen direkte Rückmeldungen zu städtischen Projekten. Mehr dazu im CUT-Projektbericht.
Interoperabilität und Skalierbarkeit
Offene Standards und Schnittstellen sorgen dafür, dass Systeme problemlos miteinander kommunizieren können. Dies erleichtert die Implementierung neuer Technologien und macht sie für andere Städte adaptierbar. Open Source spielt dabei eine entscheidende Rolle, wie die Studie "Open Source Software in Kommunen etablieren" zeigt. Kommunen wie Schwäbisch Hall nutzen Open Source-Lösungen, um digitale Plattformen zu erstellen, die kosteneffizient und leicht anpassbar sind. Dies fördert die Zusammenarbeit zwischen Städten und erleichtert die Nachnutzung bewährter Lösungen.
Open Data und IoT
Die Kombination von Datahubs mit Internet-of-Things (IoT)-Technologien bietet immense Vorteile. Sensoren in der Stadt können z. B. Luftqualität, Verkehr oder Energieverbrauch messen. Diese Daten fließen in den Datahub ein und werden über offene Standards bereitgestellt. Laut DIN SPEC 91357 ist dies ein Schlüssel zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit.
Fazit und Ausblick
Datahubs und Connected Urban Twins sind zentrale Bausteine für die Stadtentwicklung der Zukunft. Sie verbinden physische und digitale Infrastrukturen, ermöglichen datengetriebene Entscheidungen und fördern eine nachhaltige sowie bürgerorientierte Stadtentwicklung. Zusammen mit Konzepten der integrierten Stadtentwicklung und Smart Cities entsteht ein ganzheitlicher Ansatz, der die Lebensqualität in urbanen Räumen nachhaltig verbessert.
In Zukunft wird die Weiterentwicklung offener Standards und die stärkere Einbindung von Künstlicher Intelligenz (KI) eine noch tiefere Integration ermöglichen. Städte können so nicht nur smarter, sondern auch resilienter und inklusiver werden.

- Details
- Geschrieben von: Moritz Conjé
- Kategorie: Gesellschaft
Im vorherigen Beitrag haben wir die Grundlagen moderner Stadtentwicklung beleuchtet und dabei die Bedeutung der integrierten Stadtentwicklung hervorgehoben. Nun richten wir den Fokus das Konzept Smart Cities und den Einfluss auf Stadtentwicklung. Wie können digitale Technologien die Gestaltung und Steuerung urbaner Räume unterstützen? Und welche räumlichen Wirkungen gehen mit diesen Innovationen einher? - Stadtentwicklung im Wandel - Link zu Teil 1.
Die Digitalisierung hat das Potenzial, sowohl die Effizienz städtischer Prozesse zu steigern als auch die Lebensqualität der Bürger zu verbessern. In diesem Beitrag setzen wir den Begriff "Smart City" in Bezug zur Stadtentwicklung und gehen insbesondere auf die räumlichen Auswirkungen sowie die Rolle der Digitalisierung ein.
Was ist eine Smart City?
Eine Smart City nutzt digitale Technologien, um urbane Herausforderungen zu bewältigen und die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern. Dabei stehen nicht nur technische Innovationen im Fokus, sondern auch soziale und ökologische Ziele. Die Bundesregierung beschreibt Smart Cities als Teil einer nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung, bei der digitale Werkzeuge wie Datenplattformen, Sensorik und digitale Zwillinge eingesetzt werden, um städtische Prozesse effizienter und bürgerorientierter zu gestalten. Mehr dazu auf smart-city-dialog.de.
Ein zentrales Merkmal einer Smart City ist die Integration von digitalen Lösungen in bestehende Planungs- und Verwaltungsstrukturen. Dadurch können städtebauliche Ziele wie Mobilität, Nachhaltigkeit und soziale Inklusion erreicht werden. Beispiele für smarte Anwendungen sind Verkehrssteuerungssysteme, die Echtzeitdaten nutzen, oder digitale Partizipationsplattformen, die die Mitgestaltung der Bürger fördern. Ein Beispiel für Verkehrssteuerung ist die "Flowbird"-Plattform, die Parkraummanagement und Verkehrssteuerung integriert und Echtzeitdaten für eine effizientere Verkehrslenkung bereitstellt (Flowbird). Für digitale Partizipationsplattformen ist "Consul" ein herausragendes Beispiel, eine Open-Source-Plattform, die weltweit für Bürgerbeteiligungsprozesse genutzt wird (Consul Project).
Smart City und integrierte Stadtentwicklung
Die Verbindung von Smart-City-Technologien mit integrierter Stadtentwicklung ermöglicht einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem technische Lösungen zur Erreichung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Ziele eingesetzt werden. Während die integrierte Stadtentwicklung verschiedene Akteure und Themenfelder verbindet, können digitale Technologien diese Prozesse beschleunigen und vereinfachen. Ein Beispiel hierfür ist die Nutzung von digitalen Zwillingen, die es ermöglichen, städtebauliche Szenarien virtuell zu simulieren und Entscheidungen datenbasiert zu treffen. Ein praktisches Beispiel hierfür ist der Digitale Zwilling von München, der komplexe Stadtentwicklungsprojekte wie Verkehrsanpassungen und Neubauplanungen durch Simulationen unterstützt und Entscheidungsprozesse beschleunigt (muenchen.digital). Ein weiteres Beispiel ist Singapur mit seinem "Virtual Singapore"-Projekt, das eine 3D-Plattform bereitstellt, um die städtische Planung zu optimieren und Nachhaltigkeitsziele datenbasiert zu erreichen (Virtual Singapore).
Räumliche Wirkung von Smart Cities
Smart Cities wirken sich direkt auf den städtischen Raum aus. Digitale Technologien können dazu beitragen, Verkehrsflüsse zu optimieren, urbane Räume nachhaltiger zu gestalten und die Zugänglichkeit zu verbessern. Gleichzeitig können unbeabsichtigte Effekte auftreten, etwa eine soziale Exklusion durch digitale Barrieren oder die Verdrängung durch steigende Immobilienpreise. Mehr zu den räumlichen Wirkungen auf bbsr.bund.de.
Ein gelungenes Beispiel für die räumliche Wirkung von Smart-City-Technologien ist das Verkehrsmanagement in København, bei dem intelligente Ampelschaltungen und Echtzeitdaten zu einer signifikanten Reduktion des Verkehrsaufkommens beigetragen haben (Cycling Embassy of Denmark). Vergleichbare Projekte in Deutschland, wie die "Smart Parking"-Initiativen in der KielRegion, zeigen, wie digitale Tools zur Verbesserung der Mobilität und des Umweltmanagements eingesetzt werden können (KielRegion Smart Parking).
Fazit
Smart Cities bieten ein enormes Potenzial, um städtische Herausforderungen im digitalen Zeitalter zu meistern. Sie erweitern die Möglichkeiten der Stadtentwicklung und ermöglichen eine effizientere und bürgerfreundlichere Gestaltung urbaner Räume. Gleichzeitig erfordern sie jedoch einen bewussten Umgang mit sozialen und ökologischen Aspekten, um unbeabsichtigte Folgen zu vermeiden.
Im nächsten Beitrag "Smart Cities und Stadtentwicklung: Potenziale von Datahubs und Connected Urban Twins" setzen wir den Fokus auf die praktische Umsetzung dieser Technologien und zeigen, wie datengetriebene Ansätze die Zukunft der Stadtgestaltung prägen können.










